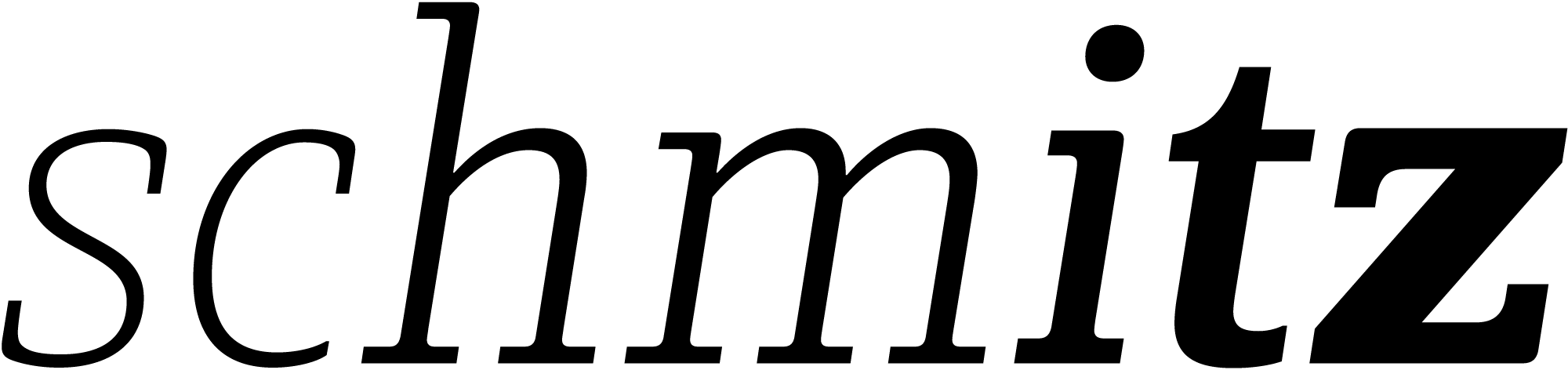Er braucht den Sport wie die Luft zum Atmen. Florian ist 21 Jahre alt und hat seinen ersten Ironman vollendet. Für ihn ist Triathlon nicht nur ein Hobby – es ist seine Lebenseinstellung.
Am Tag vor dem Ironman reist Florian zusammen mit seinen Eltern nach Roth. «Sobald du dort ankommst und einen der ‹Welcome Triathletes!›-Banner siehst, checkst du erst wirklich, dass es jetzt bald losgeht. Ab da war ich richtig nervös und aufgewühlt. Die Gänsehaut war erst wieder weg, als ich nach dem Wochenende zuhause war.» Der Samstag geht an Florian vorbei wie im Traum. Kleiderbeutel abgeben, das Fahrrad einchecken, Startnummer abholen. Alles scheint ihm unwirklich und weit entfernt. «Ich habe nur noch an den Start gedacht, meine Gedanken kreisten darum, wann es endlich losgeht. Hätte meine Oma mir keine Baldriantabletten gegeben, hätte ich die Nacht wahrscheinlich durchgemacht und gar keine Ruhe gefunden.» Der Wettkampfmorgen dämmert. Um halb fünf steht Florian auf – zum Frühstück gibt es zwei Teller Nudelsalat. «Sobald du aufwachst, merkst du, es ist was Großes in der Luft, die Atmosphäre ist auf eine gute Weise angespannt. Auf dem Gelände ist schon einiges los, alle sind unglaublich positiv drauf und du kannst die Vorfreude richtig spüren.» Die Theatralik der Situation wird vom Veranstalter durch beeindruckende Musik auf dem ganzen Gelände nur noch verstärkt.
«Deine Anspannung steigt und steigt, dir wird langsam schlecht und du denkst: ‹Endlich, heute ist es soweit!›»
Auf dem Gelände sind rund fünftausend Triathleten unterwegs, alle überprüfen nochmal ihre Ausrüstung. Manche sind nervös, andere scheinen in sich selbst zu ruhen – jeder bereitet sich an diesem Morgen anders auf den Wettkampf vor. Florian sieht sich den Start der Profis an, deren Gruppe als Erstes auf die Strecke darf. «Die Stimmung dort ist unglaublich motivierend und heizt dich nochmal richtig auf.» Um 7:55 Uhr geht es für Florians Startgruppe los. In seiner Altersklasse starten nur gut zwanzig Sportler – bei der Langdistanz haben die Athleten, die etwa dreißig Jahre alt sind, den klaren Vorteil. Damit gehört Florian mit 21 Jahren zu einer echten Seltenheit.
Tunnelblick
Vor dem Start will er nur eins: weg. «Ich war richtig panisch, kurz bevor es losging. Ich wusste, was es für eine Quälerei werden würde. Als ich dann im Wasser war und auf den Start gewartet habe, war ich eigentlich schon total am Ende», erzählt er. Der zehnsekündige Countdown beginnt, der Startschuss fällt – und die Nervosität ist verschwunden. «Ich war von einer Sekunde auf die andere ruhig. Ich musste einfach nur noch mein gewohntes Programm durchziehen. Schwimmen, Rad fahren, laufen. Das Schwimmen ist richtig hart. Es sind dutzende Athleten gleichzeitig im Wasser, da lässt es sich nicht vermeiden, dass du mal einen Tritt abbekommst oder unter Wasser gedrückt wirst. Trotzdem lief es eigentlich richtig super.» Eine leichte Untertreibung: Nach 54 Minuten rennt er aus dem Wasser und ist damit schneller als die spätere Siegerin der Frauen, Yvonne Van Vlerken. In der Gesamtwertung belegt er zu diesem Zeitpunkt damit den 48. Platz. Die Radstrecke von insgesamt 180 Kilometern wird beim Wettkampf in Roth in zwei Runden gefahren. Den ersten Teil geht Florian locker an, um sich nicht zu früh zu verausgaben. Er fährt im Schnitt eine Geschwindigkeit von 32 Kilometern pro Stunde, was genau in seinem Plan liegt. «Ich war in der ersten Runde richtig gut drauf, was mich selbst überrascht hat. Trotzdem war es extrem anstrengend, was auch an der Aufregung vorher gelegen hat.» Florian motiviert sich mit dem Gedanken, dass seine Familie und Freunde an verschiedenen Posten an der Strecke stehen und auf ihn warten. Auch die Zuschauer an der Strecke geben ihm immer wieder Kraft, obwohl Triathlon mit den vielen, einsamen Trainingseinheiten eigentlich als Einzelkampf gilt. «Ironman ist zu fünfzig Prozent mental und der Rest ist Kopfsache. Das ist ein altes Triathleten-Sprichwort.» Damit soll er Recht behalten.
Dann kommt der Westwind
In der zweiten Runde der Radstrecke kommt dann der Einbruch. Die Verpflegung, die er als Teilnehmer selber platzieren darf, reicht nicht mehr aus. «Ich habe ein bisschen zu viel gegessen. Aber wahrscheinlich habe ich’s gebraucht», erklärt er, «Ich musste auf die Verpflegung vom Veranstalter zurückgreifen, und das war widerliches Zeug. Das habe ich absolut nicht vertragen.» Außerdem muss er jetzt gegen einen starken Gegenwind anfahren, was sein Tempo zusätzlich drosselt. Die nächsten neunzig Kilometer werden zur Tortur – nur noch Wasser, Cola und isotonische Getränke bekommt er runter, bei allem anderen rebelliert sein Magen. «Ich bin mit dem Gefühl, dass ich jetzt aufhöre, in die Wechselzone gefahren.» Die positive Einstellung, die Florian sich mit den Jahren angewöhnt hat, findet hier ihre Grenze. Im Zelt, wo die Athleten sich für die Laufstrecke umziehen, sitzt er zehn Minuten fertig umgezogen auf einer Bank und kann sich nicht entscheiden: Gibt er auf, oder versucht er weiterzumachen?
«Ich habe echt lange mit mir gerungen. Mir ging es richtig schlecht, trotzdem war immer noch etwas von dem Willen da, die Sache durchzuziehen.»
Als er das Zelt verlässt, erfährt er, dass seine Cousine, zu diesem Zeitpunkt hochschwanger, doch noch zum Zielstadion kommt. Eigentlich hatte sie vorher bereits abgesagt. Für Florian ist das genau der Motivationsschub, den er braucht. «Wenn sie ins Ziel kommt, muss ich da auch hin.» Eine verquere Logik, aber er läuft los. Im Training hat er sich für die Laufstrecke am Wettkampftag eine Taktik zurechtgelegt: «In meinem Kopf war fest eingebrannt: ‹Zwischen den Verpflegungsstellen läufst du. Du gehst nicht.›» Es ist ein Mantra, welches sich mit der Zeit in seinem Kopf verankert hat. Auf den ersten Kilometern klappt diese Taktik richtig gut: An jeder Verpflegungsstelle nimmt er Wasser oder Cola zu sich. Keine feste Nahrung, der Magen spielt immer noch nicht mit. Dann läuft er die zwei Kilometer bis zur nächsten Stelle weiter. «Die Laufstrecke ist der einsamste Teil des ganzen Wettkampfs», erzählt er. Zehn Kilometer am Main- Donau-Kanal entlang, durch ein Dorf, fünfzehn Kilometer zurück. Dann geht es mit einer Schleife wieder nach Roth.
Bis zur Schmerzgrenze und weiter
Es ist heiß, die Sonne brennt und es gibt kaum Publikum. «Ich wollte einfach nur noch aufhören und schlafen. Ich war total fertig. Aber etwas hat mich davon abgehalten, aufzuhören.» Bei Kilometer 27 kommt der Umbruch im Kopf:
«Alles, was ich jetzt laufe, bringt mich näher zum Ziel – also auch zu meinem eigenen Ziel, den Wettkampf zu schaffen. Das hat mich dann wieder ein bisschen angeschoben. Trotzdem realisierst du noch gar nicht, dass du es wirklich schaffen kannst, es sind schließlich noch fünfzehn Kilometer zu laufen.»
Florian läuft jetzt gar nicht mehr bewusst – er ist in sich versunken. Das Zeitgefühl geht verloren, er rennt wie in einem Rausch. Endlich kommt er in Roth an. Jetzt hat er noch knapp vier Kilometer vor sich. «Ich hatte es immer noch nicht begriffen, dass ich jetzt gleich im Ziel bin. Du bist schon zwölf Stunden unterwegs, und dann jammerst du wegen vier Kilometer, was fast lächerlich ist. Bis zum Kilometer 40 hatte ich immer noch den Gedanken, dass ich aufhöre.» Dieses Gefühl zieht sich bis zu den letzten Metern vor das Zielstadion hin. Erst, als seine Füße den roten Teppich im Zielstadion berühren, kommt langsam das Bewusstsein, was er da gerade geschafft hat. Nach zwölf Stunden und 38 Minuten kippt seine Stimmung von kompletter Erschöpfung zum totalen Glück. «Plötzlich siehst du das Ziel. Du hörst den Stadionsprecher jeden einzelnen Athleten ankündigen, die Menge jubelt. Du biegst auf den roten Teppich ab, und denkst: ‹Verdammt, ich hab’s wirklich geschafft.› Dann fließen die Tränen, du hast keine Schmerzen mehr und empfindest nur noch Euphorie.»