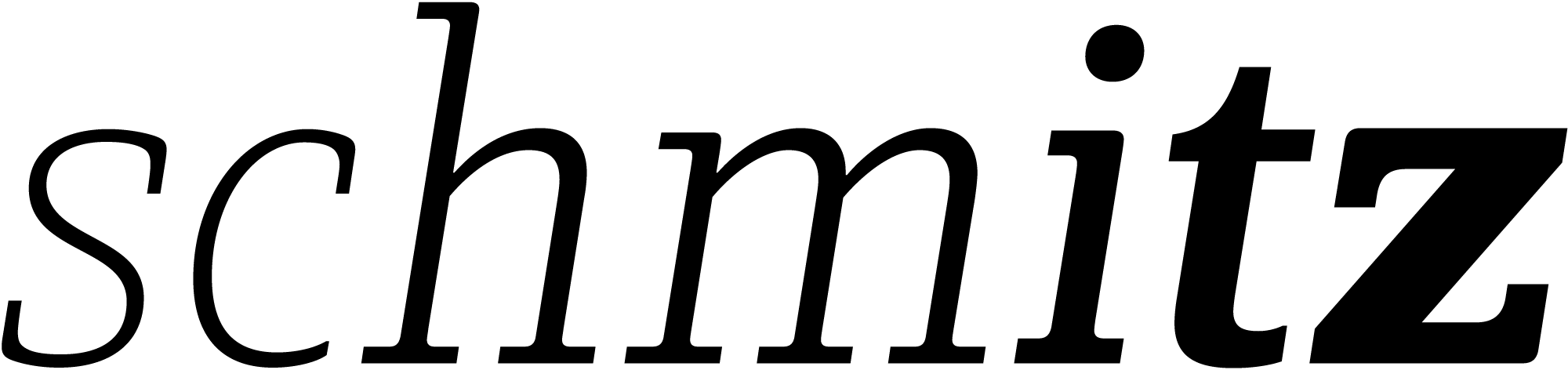Der Geschmack von Tod beißt auf meiner Zunge. Zwei Hände packen mich und pressen mich gegen kühlen Stoff. Zwölf weitere Hände zerren gleichzeitig Gurte aus Leder fest: an beiden Armen, beiden Fußgelenken, meiner Brust und meiner Hüfte. Kalter Schweiß auf meiner Haut, Blut gefriert in meinen Adern. Durch eine Scheibe starren sie mich an: Wenige wirken entspannt, schon fast amüsiert;
viele blicken verschreckt, ein paar weinen. Ich kann kaum mehr atmen. Alles riecht metallisch. Ängstlich schnellt mein Blick durch den Raum.
Es beginnt
Schweißgebadet schrecke ich auf. Ein Traum. Nur ein Traum. Ich bin erleichtert. Doch ein flaues Gefühl breitet sich in mir aus. Ich habe nur noch eine Woche. Sieben Tage. Dann ist alles vorbei. Mein Leben. Meine Gefangenschaft. Ich blicke mich um. Die grauen Wände schauen mir entgegen. Es ist kalt. Das Atmen sticht mir im Hals. Wieder breitet sich die Angst in mir aus. Was ist, wenn ich Schmerzen habe? Was ist, wenn etwas schief geht?
Fragen, die mich seit vielen Jahren schon belasten. Doch nun werden sie immer spürbarer. Der Tag naht mit rasender Geschwindigkeit. Es gibt nichts, was ich dagegen unternehmen kann. Ich fühle mich machtlos. Schritte nähern sich. Mein Tag beginnt. Er läuft ab wie ein gut geöltes Uhrwerk. Die Wärter schauen, ob jeder von uns die Nacht überstanden hat und keiner ein schnelleres, vielleicht sogar schmerzfreieres Ende gewählt hat. Danach müssen manche ihrer Arbeit nachgehen, andere haben dieses Privileg nicht. Sie sind den ganzen Tag allein. Allein mit den Gedanken. Allein mit der Dunkelheit. Heute ist die Dunkelheit ein Teil von mir.
Anfang und Ende
Vor 22 Jahren wurde mein Schicksal mit einem Hammerschlag besiegelt. Der Gerichtssaal war voll. Die Geschworenen lauschten gespannt der Anklage und bildeten sich schnell ein Urteil. Mein Anwalt war noch jung und unerfahren. Keiner wollte meine Wahrheit hören. Ich gestand vieles, was ich in meinem Leben getan habe. Doch das, wofür ich angeklagt wurde, habe ich nicht begangen. Ich bin vieles und ganz sicher kein guter Mensch, doch eines bin ich nicht: Ich bin kein Mörder. Ich hatte eine Familie, Kinder, einen guten Job. Mein Leben war perfekt. Doch mit nur einem Tag war alles vorbei. Ich deckte illegale Geschäfte in meiner Firma auf und legte mich mit den falschen Leuten an. Sie drohten meine Kinder zu ermorden, wenn ich mich nicht raushalte. Ich konnte nicht wegsehen. Während ich Blaubeerpfannkuchen für meine Kinder kochte, stürmte die Polizei unser Haus. Mein Chef wurde ermordet. Alle vorhandenen Beweise deuteten auf mich. Danach ging alles schnell. Mir wurde der Mord angehängt.
Dunkelheit
Der Staatsanwalt wollte dies nicht hören. Selbst mein Anwalt zweifelte an meiner Geschichte. Ich hörte nur das dumpfe Geräusch, als der Richter den Hammer auf den Resonanzblock schlug und das Urteil verkündete. Todesstrafe. Panik breitete sich in mir aus. Hinter mir hörte ich ein erleichtertes Geräusch von der Familie des Opfers. Sie freuten sich über mein Schicksal. Ich hatte keine Kraft mehr, mich zu wehren, zu beteuern: Ich bin unschuldig!
Jeden Tag in meiner Zelle denke ich an diese Verhandlung. Die Gesichter der Geschworenen. Die Freude der Angehörigen. Das Einzige, was mich ablenkt, sind die Briefe. Einmal in der Woche erhalte ich einen aus Deutschland von meiner Brieffreundin. Ich dachte mir am Anfang: Wer will eine Brieffreundschaft mit einem Mörder. Doch als ich von der Initiative gegen die Todesstrafe und ihrem Angebot hörte, willigte ich, ohne nachzudenken, ein. Sofort setzte ich mich hin und arbeitete an meinem Steckbrief. Ich schrieb meine Geschichte auf und spürte es zum ersten Mal: Erleichterung. Doch ich zweifelte auch: Wer glaubt dir schon? Ich erinnerte mich an all das, was meine Familie seit meiner Anzeige mitmachen musste. Bedrückt dachte ich darüber nach. Sollte ich diese Last wirklich noch einmal jemandem zumuten? Nach langem Überlegen überwand ich meine Sorgen und schrieb meine Geschichte zu Ende. Schon nach vier Tagen kam ein Wärter zu mir und erzählte mir freudig: Sie haben dich genommen. Das erste Mal seit 22 Jahren hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Hoffnung stieg in mir auf. Vielleicht war es doch noch nicht zu Ende.
Hoffnungsschimmer
Jedes Mal, wenn ich seither einen Brief erhalte, erhellt sich meine Zelle. Die Dunkelheit wird weniger. Ich bin nicht mehr allein. Es gibt Leute, die an mich glauben, denen ich noch etwas bedeute. Meine Eltern sind verstorben und meinen Kindern wurde der Kontakt zu mir untersagt. Ich denke immer, es ist besser für sie. So müssen sie nicht leiden, werden nicht gemobbt. Doch jetzt ändert sich alles. Jede Woche freue ich mich wie ein kleines Kind auf einen Brief. Anfangs hat es sehr lange gedauert. Doch jetzt pflege ich mehrere Brieffreundschaften, vier Stück. Das macht mich stolz. Ich habe an dem wohl traurigsten, dunkelsten und einsamsten Ort der Welt jemanden gefunden. Jemand der sich für mich einsetzt; der eine Strafumwandlung für mich erreichen will. Doch das ist nicht das Einzige, worüber wir schreiben. Hauptsächlich geht es um ihr Leben. Sie erzählt mir von ihrer Arbeit, von ihren Kindern, ihrer Familie. So kann ich ein Teil davon sein, auch wenn ich über siebentausend Kilometer weit weg bin. Sie setzt sich für mich ein. Hat sich darum gekümmert, dass ich beim Innocence Project genommen werden. Sie erzählt mir genau, was das ist. Es ist eine Gruppe von jungen Anwälten, die sich um die Haftumwandlung kümmern. So versucht sie mir das Leben zu retten.
Heute habe ich mich mit meinem Schicksal abgefunden. Ich bin glücklich. Auch wenn die Anwälte meinen Fall nicht gewinnen, kann ich mit einem Lächeln gehen. Die Alpträume sind weniger geworden. Vielleicht verschwinden sie noch vor meinem Ende. Noch zwei Tage. Ich habe meinen Frieden gefunden. Fühle mich nicht mehr ängstlich. Auf eine gewisse Weise freue ich mich sogar. Das erste Mal seit 22 Jahren bekomme ich zum Essen, was ich mir wünsche. Ich habe mich für Blaubeerpfannkuchen entschieden. Für mich sind sie eine Erinnerung an meine Kindheit und an meine Kinder. Es konnten nie genug Blaubeeren sein. Wenn ich daran denke, habe ich immer noch den süßlichen Geruch in der Nase.
Noch ein Tag. Ich bin nervös. Meine Angst kommt langsam wieder. Ein Wärter erklärt mir den Ablauf. Ich kann nicht richtig zuhören. Ich denke an die Menschen, denen ich etwas bedeute, und bereue, sie in mein Leben gelassen zu haben. Morgen werde ich sie alle verletzen. Ein Knoten schnürt sich um meine Brust. Das Einzige, was ich ihnen geben kann, ist ein letztes Telefonat. Wir werden dann das letzte Mal unsere Stimmen hören. Der Gedanke daran macht mich traurig. Ich versuche ihn zu verdrängen. Leider gelingt es mir nicht. Außen ist lauter Tumult. Die Gefangenen meinen, sie haben eine Chance gegen die Wärter. Nach meiner langen Zeit hier weiß ich, es ist nicht so. Ich lege mich hin. Heute fühlt sich sogar das durchgelegene, fleckige Bett bequem an. Langsam schließe ich meine Augen und versuche zu schlafen. Ein letztes Mal. Es gelingt mir nicht. Meine Angst vor dem Kommenden ist zu groß.
Letzte Reise
Ein lauter Schlag. Jemand klopft gegen die Gitterstäbe meiner Zellentür. Ich schrecke auf. Anscheinend bin ich doch weggenickt. Ein Wärter steht vor mir, um mich abzuholen. Seine Gesichtszüge wirken gleichgültig. Er riecht nach Schnaps. Benommen stehe ich auf und laufe langsam auf ihn zu. Er legt mir Fesseln an. Sie sind kalt. Als ich in den Hof trete, kann ich meine Augen kaum offenhalten. Die Sonne ist grell. Sie fühlt sich warm an, ich hatte schon fast vergessen, wie das ist. Ich blicke mich um. Rieche die frische Luft. Fühle mich für einen kleinen Augenblick frei. Dann trifft mein Blick einen weißen SUV. Die Angst trifft mich wie ein Schlag. Ich werde zu ihm hingeführt und steige ein. Die Motorengeräusche durchdringen die Stille. Die Fahrt kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Ich fühle mich wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal Häuser, Autos und Bäume sieht. Mit offenem Mund sitze ich da – es hat sich so viel verändert. In dieser Welt würde ich mich nicht mehr zurechtfinden. Ich ertappe mich bei dem Gedanken: In ein paar Stunden bist du tot. Schnell versuche ich an etwas anderes zu denken. Doch es fällt mir schwer. Mein Ende ist besiegelt. Ich blicke aus dem Fenster und frage den Fahrer, ob er es ein kleines Stück öffnen kann. Er willigt nach kurzem Zögern ein und öffnete das Fenster einen kleinen Spalt. Die schwüle Luft weht mir um die Nase. Ich glaube, es riecht nach Abgasen. Doch sicher bin ich mir nicht. Ich atme tief ein. Wir fahren durch ein kleines Dorf. Es hat nicht einmal zehn Häuser. Am Gehsteig spielen ein paar Kinder. Zwei Erwachsene unterhalten sich. Sie schauen mich nur kurz an. An den Anblick des Todes auf Rädern sind sie gewöhnt. Traurig. Es ist ihnen gleichgültig.
Eine gefühlte Stunde später lese ich es auf dem Ortsschild: Huntsville. Wir sind da. Hier werde ich meine Ruhe finden müssen. Unser Weg führt durch die gesamte Stadt an Geschäften und Diners vorbei. Der Duft von Blaubeerpfannkuchen steigt mir in die Nase und ruft alte Erinnerungen ins Leben. Glücksgefühle breiten sich in mir aus. Sie werden durch den Anblick des großen Friedhofs zerschlagen: Hier ist sie, meine Ruhestätte. Der Wagen wird langsamer, bis er schließlich anhält. Ich schaue mich um und sehe ein großes Tor. Meine Angst ist zurück. Sie ist stärker als je zuvor. Hektisch sehe ich mich um. Suche einen Ausweg. An der Straßenseite stehen ein paar Menschen. Sie protestieren. Protestieren für mich. Für Menschen, die das gleiche Schicksal erwartet. Das riesige Tor öffnet sich quietschend und der SUV fährt langsam hindurch. Hinter mir höre ich noch das dumpfe Geräusch des Tores, als es verschlossen wird. In diesem Moment verschwindet all meine Hoffnung. Ich werde sterben. Ein junger Wärter begleitet mich in das große Gefängnis. Es wirkt verlassen, hier gibt es schon seit einiger Zeit keine Gefangenen mehr. Es existiert nur noch aus einem Grund – Tod. Innen angekommen werde ich wieder eingesperrt. Es ist eine alte, kalte Zelle. Sie riecht modrig. Vor dem Betreten habe ich den Ort gesehen, an dem früher die Gefangen hingerichtet wurden. Man muss sich das so vorstellen. Es ist wie ein breiter Gang mit fünf Zellen. Am Ende des Ganges stand früher der elektrische Stuhl. Hier wurde man vor den Augen aller umgebracht. Diese Methode gibt es zum Glück hier in Texas nicht mehr.
Nervosität steigt in mir auf. Die Zeit steht still. Ich schrecke auf: Schritte. Sie holen mich. Diesmal ist es ein anderer Wärter. Er sagt mir, ich könne nun meine Anrufe tätigen. Über die Reihenfolge muss ich mir keine Gedanken machen. Sie wurde festgelegt. Es war schwer, ich konnte mich lange nicht entscheiden. Mit zitternden Händen hebe ich den Hörer ab. Mein erstes Telefonat ist mit meinen Kindern. Ich wollte sie nicht dabeihaben, sie sollen mich nicht sterben sehen. Wir reden über alles. Wirklich alles. Weinen. Lachen. Doch dann wird mir bewusst, ich höre ihre Stimmen zum letzten Mal. Ich bekomme kein Wort mehr heraus. Schluchzend sage ich ihnen: Ich liebe euch. Passt gut auf euch auf. Es gelingt mir fast nicht mehr den Hörer aufzulegen. Ich breche zusammen. Zittere. Weiß in diesem Moment nicht, wie ich noch vier Anrufe überstehen soll und würde am liebsten die Zeit vorspulen.
Die nächsten Anrufe waren leichter, doch jetzt kommt der Letzte. Mir war schlecht vor Angst und Aufregung. Jetzt werde ich das erste Mal die Stimme meiner Brieffreundin hören. Ich habe ihr versprochen: Wir führen das letzte Gespräch. Insgeheim habe ich immer gehofft, sie würde mir da durchhelfen. Aufgeregt hebe ich ab. Hallo. Ihre Stimme klingt weich, höflich und beruhigt mich. Doch ich merke ihr die Nervosität an. Höre das Zittern in ihrer Stimme. Auch sie hat Angst vor meinem Schicksal. Sie erzählt mir ein letztes Mal von ihren Kindern, ihrem Mann. Ich höre zu und spüre, wie sich mein Puls senkt. Wir redeten mindestens eine Stunde, bis der Wärter kommt und sagt, mein Essen sei fertig. Diese Worte habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Es gab immer zu den gleichen Zeiten morgens und abends Essen. Keine Ausnahme. Doch hier war das anders. Vor ein paar Tagen habe ich mich noch auf mein Mahl gefreut. Jetzt bekomme ich keinen Bissen herunter. Der Wärter ist freundlich und sagt, ich kann mir noch Zeit lassen. Doch was bringt mir das? Ich kann nicht entkommen. Trotz der Übelkeit versuche ich einen Bissen Blaubeerpfannkuchen und breche erneut in Tränen aus. Es wird immer realer. Ich werde meine Kinder nie wiedersehen.
Erneut kommt der Wärter. Ich weiß, es ist so weit. Er legt mir wieder die Fesseln an und führt mich hinaus. Ich spüre den kalten Schweiß auf meiner Haut. Mir ist schlecht. Wir gehen durch einen langen Flur mit vielen Türen. Eine davon steht einen Spalt offen und ich kann einen letzten Blick in die ersehnte Freiheit durch das Fenster erhaschen. Mein Begleiter führt mich weiter in einen großen dunklen Raum. Am Ende des Raumes sehe ich eine Tür, hinter ihr Licht. Hier ist es. Er begleitet mich hinein und bittet mich, mich auf den Bahren zu legen. Um mich herum stehen mehrere Männer; falls ich mich wehre. Doch ich weiß, es wäre zwecklos. Sie legen mir die Gurte an – ich fühle mich wie in meinen Alptraum.